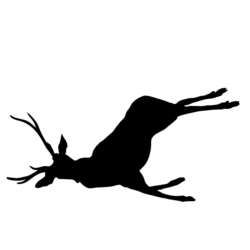Redebeitrag zum Antisemitismus im deutschen Kunst- und Kulturbetrieb, gehalten auf der antifaschistischen Demonstration in Berlin-Moabit in Gedenken an die Novemberpogrome von 1938.
Liebe Antifaschistinnen und Antifaschisten,
vor wenigen Wochen jährte sich der antisemitische und rassistische Anschlag in Halle zum dritten Mal. Ein bewaffneter Rechtsterrorist hatte versucht, sich an Jom Kippur Zugang zur Synagoge zu verschaffen. Als er scheiterte, erschoss er die Passantin Jana L. auf der Straße vor der Synagoge und Kevin S. in einem nahe gelegenen Imbiss. Es gibt absolut keinen Grund, auch nur einen Moment an der Gefährlichkeit des mörderischen Antisemitismus von rechts zu zweifeln.
Dennoch zeigte sich in diesem Jahr so deutlich wie selten zuvor, dass Antisemitismus als gesellschaftliches Phänomen auch gerade dort zu finden ist, wo er gemeinhin weniger vermutet wird. Etwa in der achso weltoffenen deutschen Kulturlandschaft, wo die Kunstschau „documenta“ eindrucksvoll bestätigte, wie berechtigt die Warnungen vor der Nähe ihrer Kurator_innen zur antisemitischen BDS-Bewegung von Anfang an gewesen waren. Zum Vorschein kamen am laufenden Band Beispiele von Antisemitismus in der ausgestellten Kunst. Das Kurator_innenkollektiv aus Indonesien versuchte die Kritik mit Rassismusvorwürfen abzuwehren. Ihre Unterstützer_innen in den Feuilletons rechtfertigten den israelbezogenen Antisemitismus der Kunstwerke unverdrossen als überfällige postkoloniale Öffnung der „provinziellen“ Erinnerungskultur an die Shoah. Doch der Blick muss nicht nach Kassel schweifen, um auf Antisemitismus in sich progressiv gebenden Milieus zu schauen.
Während wir hier in Moabit demonstrieren, trafen sich heute am Alexanderplatz selbsternannte „Freie Geister“ für einen Spaziergang gegen eine nicht existierende Impfpflicht. Zusammengewürfelt ist diese Versammlung aus Überbleibseln der verschwörungsideologischen Proteste von Pandemie-Leugner_innen, die ihren Ursprung am Rosa-Luxemburg-Platz hatten. Dort versammelten sich von Anfang an auch Milieus, die sich eher links verorten, sich aber nach rechts bewegen. Bestes Beispiel ist einer der ursprünglichen Berliner Initiatoren, Anselm Lenz. Der Dramaturg begann seine Laufbahn in einem antikapitalistischen Theaterkollektiv und hatte sich im Zuge der Besetzung der Volksbühne, als Protest gegen einen neuen Intendanten, weiter politisiert. Inzwischen ist er nicht nur gern gesehener Gast in Gerichtssälen, sondern auch am Institut für Staatspolitik eines gewissen Götz Kubitschek in Schnellroda.
Eine Gesellschaft, die einige Vertreter_innen etablierter Berliner Kulturinstitutionen selbstverständlich empört zurückweisen würden. Sie versammeln sich lieber hinter hochtrabenden Erklärungen, die Kritik an Antisemitismus als Bedrohung für die Kunstfreiheit brandmarken. Vermutlich würden sich einige Unterzeichner_innen solcher Resolutionen von einer ebenfalls heute Abend am Neuköllner Hermannplatz stattfindenden Versammlung eher angesprochen fühlen. Unter dem Motto „Von Berlin nach Palästina: Hoch die internationale Solidarität“ sollen am 9. November im Anschluss an die antizionistische Veranstaltung dann aber auch noch artig Stolpersteine geputzt werden. Denn auf dem Ticket des offenen Dialogs und internationalistischer Phrasen wird eine unverhohlene Einseitigkeit in Bezug auf Israel gepflegt. Im Berliner Haus der Kulturen der Welt konnte bei einer Konferenz im Sommer etwa angeregt darüber philosophiert werden, wie der Staat Israel das Shoah-Gedenken instrumentalisiere, um die Kolonisierung Palästinas zu stützen. Dass eine der Organisator_innen dieser Konferenz die „documenta“ in ihrem Umgang mit Antisemitismus unterstützen sollte, schließt den Kreis mit einem Treppenwitz. Eine Besserung ist allzu schnell jedoch kaum zu erwarten. Dass die lauteste Kritik an antisemitischen Äußerungen, auch des künftigen Intendanten des HKW, nicht etwa von links oder aus dem Kulturbetrieb selbst kommt, sondern ausgerechnet von der „Bild“-Zeitung, rundet das Bild des traurigen Gesamtzustandes weiter ab. Deutschland ist nun mal immer noch Deutschland.
Doch von dem, was sich wie Ohnmacht anfühlt, lassen wir uns auch hier und heute nicht dumm machen. Die Antwort auf diese Zustände ist und bleibt emanzipatorischer Antifaschismus. Ein Antifaschismus, der Antisemitismus kritisiert ohne Rassismus zu relativieren und umgekehrt. Bezogen auf antifaschistische Gedenkpolitik heißt das, sich weder von der liberaldemokratischen “Happy End“-Erzählung vereinnahmen zu lassen, noch sich vom kritischen Gestus eines falschen Postkolonialismus in die Relativierung der Shoah und des deutschen Antisemitismus treiben zu lassen.
Gedenken heißt Handeln! Gegen jeden Antisemitismus! Nie wieder Deutschland!